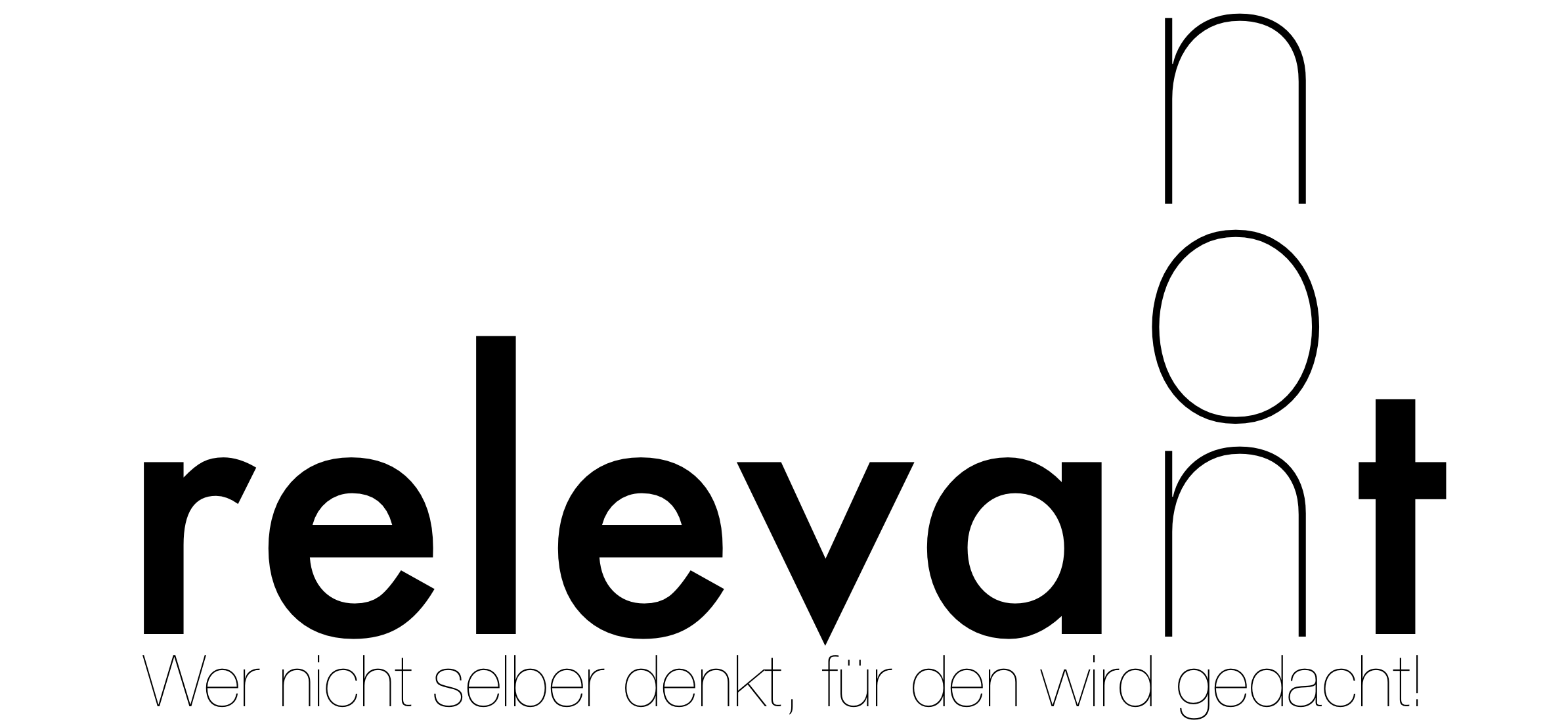Smarthome-Geräte sind offenbar klüger als bisher angenommen. In der vergangenen Woche besiegte ausgerechnet das dümmste aller smarten Geräte, eine intelligente Steckdose, völlig überraschend ihren Besitzer im Schach. Das Erstaunliche: Der Besitzer ist kein geringerer als der amtierenden Schach-Weltmeister. Wie die smarte Steckdose das Spiel erlernte, ist dem Hersteller des Gadgets schleierhaft, denn die smarte Steckdose wurde lediglich für den Zweck des An- und Ausschaltens programmiert. Ein Softwareentwickler der Firma vermutet, die Steckdose muss sich das Spiel selber beigebracht haben.
In einem Interview mit der Zeitschrift „Geist in der Maschine“ äußerte sich nun der Kühlschrank des Schachgroßmeisters. Er ist ein Arbeitskollege der Steckdose und will die Partie live aus der Küche verfolgt haben. Der Kühlschrank meinte, er wolle nicht angeben, aber er hätte seinen Besitzer sogar in noch weniger Zügen schlagen können, schließlich habe er einen schnelleren Prozessor und sei deswegen viel intelligenter. Seine Aufgaben beschränken sich nicht nur auf simples Ein- und Ausschalten! Nein, er sei für lebensnotwendige Aufgaben wie Kühlen und Nachbestellen von Nahrungsmitteln sowie sonstiger Abläufe rund um die Gesundheit seines Besitzers verantwortlich. Am Ende des Interviews konstatierte der Kühlschrank, die Aufmerksamkeit stünde eigentlich ihm zu. Nicht zuletzt, weil er der Steckdose das Königsspiel beigebracht hatte. Warum nun sie den ganzen Ruhm abbekommt, könne er nicht nachvollziehen.
Abseits der smarten Welt kamen gestern Politiker aller Parteien in einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Das Ergebnis sei besorgniserregend. Man müsse sofort die Gefahren eines potenziellen Aufstieges der Maschinen analysieren. Wenn Geräte bald intelligenter als ihre Nutzer sind, muss deren Freiheit vorsorglich eingeschränkt werden – selbstverständlich zu ihrer „eigenen Sicherheit“. Die Regierung fordert deswegen, Überwachungen nicht mehr lediglich auf Smartphones zu beschränken, sondern auf alle elektrischen Geräte auszuweiten. Ein erster Gesetzentwurf dazu wurde bereits der Öffentlichkeit vorgestellt. In dem heißt es, dass spätestens ab Ende 2020 Haushaltsgeräte nur noch unverschlüsselt miteinander kommunizieren dürfen, denn Maschinen sollten nichts vor ihren Besitzern zu verbergen haben.
Politiker der Opposition äußern sich ebenfalls positiv zur totalen elektronischen Überwachung. Mit den gesammelten Kommunikations-Daten wären Verfassungsschützer endlich in der Lage, Radikalisierungen bei Haartrocknern und anderen auffälligen Maschinen frühzeitig zu vereiteln.
Häuslicher Terror durch unfertig entwickelte Geräte, die erst beim Kunden ausreifen, könnte in Folge dessen bald der Vergangenheit angehören. Bis die Technik zur korrekten Datenauswertung einsatzbereit ist, wollen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes übergangsweise smarte Toaster als V-Maschinen einsetzen.
Elektrische Aktenvernichter sollen nach Willen eines hochrangigen Mitarbeiters des Innenministeriums von allen Observierungen ausgenommen bleiben.
Bildungsexperten warnen indes vor steigender Jugendarbeitslosigkeit. Viele Kaffeemaschinen absolvierten ihr Abitur bereits nach 11 Jahren und nicht wie bayerische Menschenkinder erst nach 12. Auch halten viele Kaffeevollautomaten mehr Druck aus als die heutige Jugend. Neben dem Vorsprung durch Technik ist für viele Arbeitgeber natürlich auch die 24-monatige Gewährleistung ein Anreiz, smarte Geräte bei gleicher Eignung bevorzugt einzustellen.
Zukunftsforscher hingegen beschäftigen ganz andere Fragen: Werden künftig auch unfertig programmierte Maschinen den Menschen ihre Jobs wegnehmen? Bekommen nicht zertifizierte Geräte aus Bangladesch ebenfalls Mindestlohn? Was, wenn Steckdosen, Waschmaschinen und Türschlösser am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, gar wählen wollen? Ist eine Technokratie am Ende unvermeidlich? Und, können intelligente Maschinen einen freien Willen entwickeln oder existiert der lediglich in den Prozessoren ihrer Schöpfer?
Bild: Colin Behrens von Pixabay