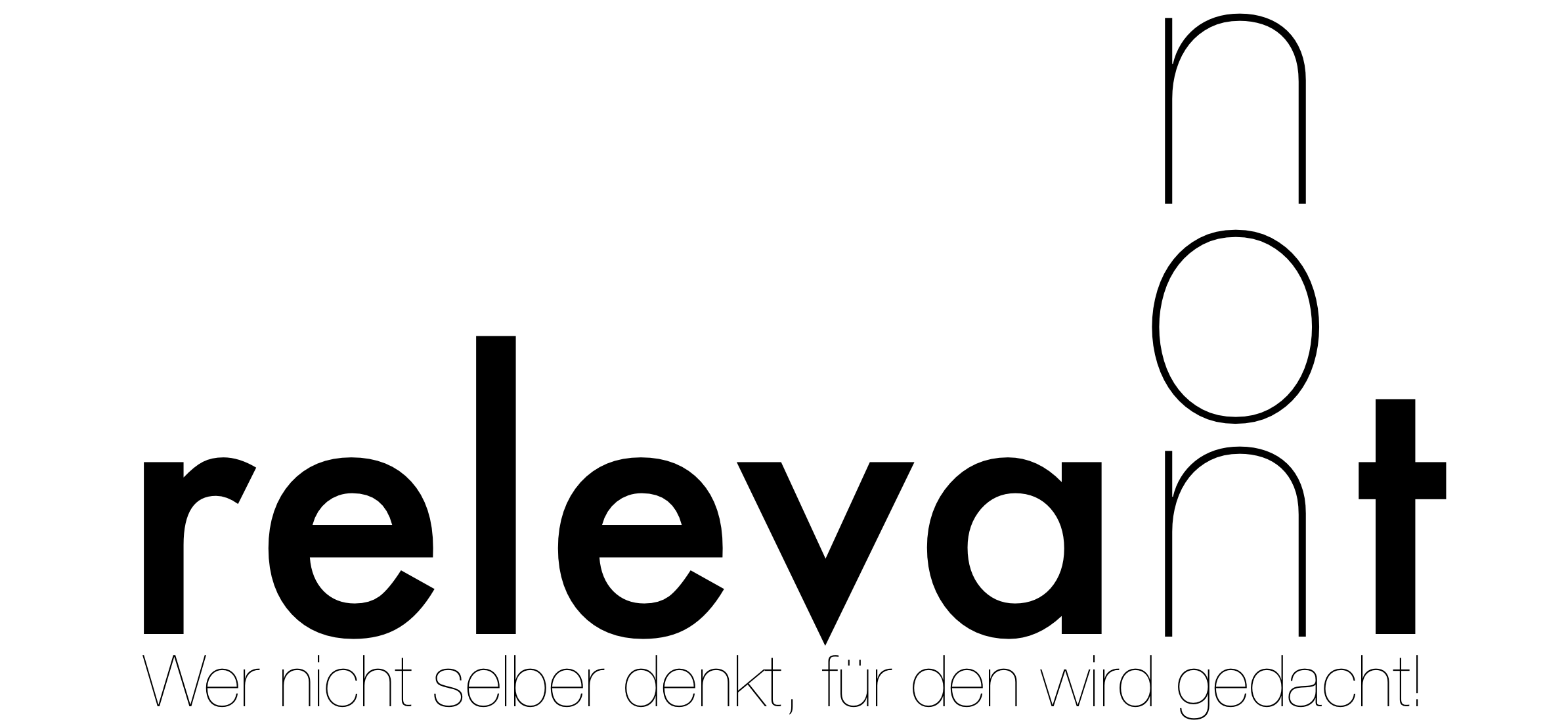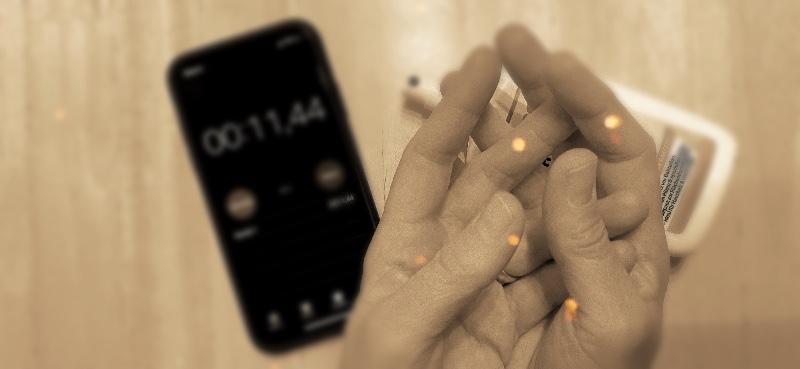Das Jahr hat eine neue Zahl. Für Menschen, die zählen können, ist das eine unbeirrbare Logik – wie der Verschleiß, der uns weiter abnutzt, obwohl wir längst stehen geblieben sind. Die Realität wird auf eine fortlaufende Ziffer reduziert, damit sie handhabbar wirkt. Altlasten wandeln sich unbemerkt in Neulasten.
Die Zahl springt, und für einen Moment tun wir so, als hätte uns die Zeit von unserem Alltag erlöst. Als hätte sie Fehler korrigiert, Altlasten entsorgt, uns neu sortiert. Hat sie nicht. Was letztes Jahr nicht funktioniert hat, wird dieses Jahr erst recht nicht funktionieren. Aber wenn wir Dinge umbenennen, tragen sie sich leichter – bis ins nächste Jahr, im Hamsterrad der Rituale.
Dabei war doch letztes Jahr angeblich schon alles gut – so pflegen wir es zumindest zu sagen. Und wenn doch bereits alles gut ist, warum wünschen wir uns dann überhaupt noch ein „gutes neues Jahr“? Ein seltsamer Reflex: widersprüchlich, aber vielleicht gehört genau das zum Ritual. Das wiederum ähnelt dem Konzept Horoskop. Hoffnung auslagern — an Zahlen, an Sterne, ans Universum, an Gott, der wenigstens so tut, als hätte er einen Plan.
Am grausamsten sind jedoch die pauschalen Wünsche. Sie werden verteilt wie Pflichtimpfungen, manchmal sogar mit Umarmung, damit es menschlicher wirkt. Ein kurzer Kontakt, maximale Bedeutungslosigkeit. Morgen erinnert sich niemand mehr daran. Der Alltag kehrt zurück, nüchtern, effizient, ungerührt. Zurück bleiben Glücksfloskeln für eine Zukunft, die längst vorbei ist.
Also gut. Die Gesellschaft verlangt es. Das Ritual verlangt es. Und ich füge mich, denn Rituale sind wichtig:
Ich wünsche Ihnen, meine lieben Leser, ein neues, besseres Jahr — denn wenn es nur gut bliebe, hätte sich ja nichts geändert. Zumindest in der Selbsttäuschung der Optimisten. Die Realität lässt sich von Floskeln aber nicht beeindrucken, sie läuft im Hintergrund weiter.
Ein gutes Neues.
Illustration: KI-generiert (GPT-5), 2026